
Behaviorismus
Die Seele ist eine „Black Box“
Es war einmal ein Psychologe, der hatte einen Hund. Mit dem machte er gerne Experimente. Er hieß Pawlow.
Also, der Psychologe hieß Pawlow, Iwan Pawlow (1849 – 1936), wie der Hund hieß, weiß ich nicht mehr.
Und wie ein Hund so ist, sabberte er viel, wenn er etwas zu fressen sah. Der Hund kam in eine Vorrichtung, die
gleichzeitig messen konnte, wieviel Speichel der Hund produzierte. Dem Hund wurde ein Leckerli gezeigt und
daraufhin fing der Hund an, ordentlich zu sabbern.
Dann wurde eine Glocke geläutet. Aber der Hund sabberte überhaupt nicht, wenn er die Glocke hörte. Warum
auch?!
Dann wurde immer wieder die Glocke geläutet und gleichzeitig das Leckerli gezeigt. Irgendwann sabberte der
Hund schon allein, wenn er die Glocke hörte. Obwohl weit und breit kein Leckerli zu sehen oder zu riechen war.
Daraus schloss Pawlow, dass der Hund etwas gelernt habe. Nämlich immer, wenn die Glocke läutet, gibt es Happi
Happi. Igor - jetzt fällt es mir wieder ein - Igor hieß der Hund, hat also auf einen Reiz (unbedingter Reiz) mit
einem angeborenen Verhalten (unbedingter Reflex) reagiert. Die Glocke wurde durch Wiederholung und in
zeitlichem Zusammenhang mit dem unbedingten Reiz zu einem bedingten Reiz. Sabbert der Hund allein schon,
wenn die Glocke ertönt, dann ist dieses Verhalten ein bedingtes Verhalten, der Reflex ein bedingter Reflex. Diese
Art von Lernen nannte Pawlow „klassische Konditionierung“.
Und schon war eine neue Psychologie geboren: der Behaviorismus.
Nein, so einfach war es natürlich nicht. An dieser wissenschaftlichen Schule waren einige Forscher beteiligt. Zum
Beispiel John B. Watson, der aus der Psychologie eine naturwissenschaftliche „objektive“ Methode machen
wollte, was eine nachvollziehbare Berechtigung hat.
Auch, wenn viele glauben, sie wären nicht konditionierbar, wie ein Hund oder eine Hündin, und weil es vielleicht
kein besonders attraktives Menschenbild darstellt, so basiert der Behaviorismus grundsätzlich auf ganz
wesentlichen und schwer von der Hand zu weisenden Prämissen.
Was tatsächlich in einem Organismus passiert, kann man mit Genauigkeit nicht sagen. Zumindest nicht von
außen. Das kann, wenn überhaupt, nur der Betroffene selbst sagen. Daher ist der Organismus für den
klassischen Behaviorismus eine „Black Box“. Oder auch unser Gehirn.
Aber man kann etwas messen, wenn die Parameter eindeutig formuliert sind: nämlich was rein geht und was
raus geht. Also den oder die Reize, die auf einen Organismus treffen und die Reaktionen, die ein Organismus
hervorbringt. Und das ist sehr gut quantifizierbar. Selbstverständlich muss das in Experimenten ganz genau
gesteuert werden.
Alle Reize, sprich die Umwelt, formt dem Behaviorismus nach (auch als Lerntheorie bekannt), die Persönlichkeit.
Tiefere seelische Ebenen, wie die Psychoanalyse vermutet, die zudem erschlossen und interpretiert oder erfühlt
werden müssen, interessieren hier nicht. Sondern nur messbare Faktoren.
Neben der „klassischen Konditionierung“ (Beispiel „Hund“) gibt es die „operante Konditionierung“, die durch
B.F. Skinner (1904 – 1990) geprägt wurde. Dabei verändert sich das Verhalten dadurch, dass es belohnt oder
bestraft wird. Alle Eltern setzen diese Methoden mehr oder weniger in der Kindererziehung ein. Wenn das Kind
brav war, dann bekommt es einen Riegel Schokolade. Das wäre eine positive Verstärkung. Wenn das Kind sich
endlich an gewünschte Regeln hält, dann wird der Stubenarrest aufgehoben und es darf sich wieder mit den
Freunden treffen. Der Stubenarrest entfällt. Das nennt man dann eine negative Verstärkung. Bei der Bestrafung
ist es umgekehrt.
Und das funktioniert eben nicht nur bei Kindern, auch Erwachsene sind dadurch formbar. Vielleicht wirkt da kein
Riegel Schokolade mehr als Belohnung, sondern eher eine Bratwurst … oder es gibt Anerkennung auf geistiger
Ebene: der „Mitarbeiter des Jahres“, oder ein verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft.
Was erlernt werden kann, kann auch wieder verlernt werden. Der Mensch hat also Einfluss auf sein eigenes
Verhalten oder das der anderen. Daraus ist die Verhaltenstherapie entstanden.
Lernen am Modell
Lernen vollzieht sich sehr häufig und im Kindesalter ganz besonders, durch die Orientierung an Vorbildern.
Kinder sind hervorragende und äußerst aufmerksame Beobachter und orientieren sich selbstverständlich
bevorzugt an ihrer Umgebung und an ihre Bezugspersonen. Sie sehen, was andere tun und imitieren deren
Verhalten gerne. Dadurch lernen sie. Man nennt dieses Lernen auch: „Lernen am Modell“. Und dieses Lernen
betrifft nicht nur das Verhalten, sondern auch Einstellungen, Werte, Urteile und Gefühlsstrukturen.
„Lernen am Modell“ ist eine sozialkognitive Lerntheorie, die von Albert Bandura (1925 – 2021) entwickelt wurde.
Das verweist auf den sozialen Aspekt der Interaktion und auf den Aspekt, dass das Beobachtete auch aktiv
verarbeitet werden kann (kognitiv). Dies passiert mit zunehmendem Alter. Dann können aber schon bestimmte
Grundlagen vorhanden sein, auf die dann unbemerkt weiter aufgebaut wird.
Karl Valentin sagte treffend. „Wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns sowieso alles nach!“
Der Lerneffekt muss nach Bandura zudem nicht sofort erkennbar werden. Er kann sich auch erst sehr viel später
zeigen oder durch Modellierungseffekte in späteren ganz unterschiedlichen Kontexten wieder auftauchen. Auch
Beschreibungen reichen schon, damit ein Lernprozess stattfindet und das Erlernte kann auf andere Bereiche
übertragen werden.
Kultur, gleichgültig welchen Inhalts und welcher Qualität, dringt so in jeden Menschen ein und wirkt.
Es gibt ein Medium, welches sich zur Konditionierung ganz besonders eignet, das ist das Fernsehen und in seiner
Erweiterung, das Internet. Denn diese Medien bieten alles, was zur Konditionierung notwendig ist:
Bilder, Emotionen, Sprache (Information und Botschaft), unterschwellige Botschaften, Belohnung („Leckerli“),
Wiederholung („Glocke“) und Verknüpfung unendlich vieler Aspekt, die nichts miteinander zu tun haben müssen
(„Leckerli und Glocke).
Und das funktioniert nicht nur bei Kindern und das weiß man!
Die Industrie nutzt diese Aspekte schon lange und daher hat Werbung einen solch hohen Stellenwert. Aber auch
die Politik und die Medien sind sich der Möglichkeiten bewusst und nutzen diese zur Meinungsbildung.
Humanistische Ansätze
Die Tiefenpsychologie und der Behaviorismus waren einseitig auf psychopathologische Erscheinungen
ausgerichtet. Das heißt, sie lagen ihren Fokus auf die „kranken“ Aspekte des Menschen. Freuds gesammelte
Werke sollen über vierhundert Äußerungen über Neurose enthalten, aber keine einzige über Gesundheit.
In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts wandten sich immer mehr Psychologen den gesunden
Aspekten des Menschen zu, bzw. fragten sich, was ist eigentlich eine gesunde Persönlichkeit und wie sieht die
Selbstverwirklichung und Entfaltung des Menschen aus? Das „warum“ der Psychoanalyse wurde ausgetauscht in
ein „wie“ und damit wurden die Fähigkeit des wachsamen Erlebens, das Bewusstsein im „Hier und Jetzt“ sowie
die Frage nach dem Sinn zu zentralen Aspekten der Betrachtung.
Die Humanistische Psychologie wollte den Menschen als Ganzes erfassen und ihn nicht in seine Einzelteile
zerlegen und diese dann untersuchen. Eine ganzheitliche Sichtweise schließt das unmittelbare Erleben des
Menschen ein und, in einer therapeutischen Situation, auch die Anwesenheit und den Einfluss des Therapeuten
mit seiner Persönlichkeit und Geschichte. Das veränderte die therapeutische Arbeit grundlegend und öffnete die
Türen für ganz neue Methoden und Ansätzen.
Kernpostulate der Humanistischen Psychologie wurden demnach:
•
Menschliche Wesen sind mehr als “die Summe ihrer Teile”
•
Menschliche Wesen leben in zwischenmenschlichen Beziehungen und Kontexten
•
Menschliches Bewusstsein beinhaltet ein Selbst-Bewusstsein, dass erweiterbar und schärfbar ist
•
Menschliche Wesen besitzen Wahlmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten – d.h. sie können entscheiden
Was ist ein gesunder und erfüllter Mensch und vor allem, wie ist er und wie fühlt, lebt und agiert dieser Mensch?
Man wandte sich dem Studium solcher erfüllten und selbstverwirklichten Menschen zu. Man wandte sich den
Themen Religion, Spiritualität und Gipfelerfahrungen zu.
“Selbstverwirklichende Menschen, Menschen also, die einen hohen Grad der Reife, Gesundheit und
Selbsterfüllung erreicht haben, können uns so viel lehren, dass sie manchmal fast wie eine andere Rasse
menschlicher Wesen erscheinen.” (Prof. Abraham H. Maslow)
Abraham Maslow (1908 – 1970) beschäftigte sich unter anderem auch mit den menschlichen Bedürfnissen. Er
postulierte, dass der Mensch seine grundlegenden Bedürfnisse würdigen sollte und sich dann den höheren
sozialen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Selbstverwirklichung zu zuwenden.
Daraus ist eine „Hierarchie der Bedürfnisse“ entstanden.
Die Humanistische Psychologie bietet nicht wirklich ein neues Persönlichkeitsmodell, in der Art, wie wir es
bisher gelesen haben, sondern eher ein besonderes Verständnis der menschlichen Natur. Sie ist eher eine
Anthropologie.
Die Grundannahmen der Humanistischen Psychologie sind:
•
Der Mensch verfügt über einen freien Willen (Freiheit satt Determinismus)
•
Der Mensch ist von Natur aus gut
•
Menschliche Werte, Kreativität und die aktive Natur des Menschen stehen im Mittelpunkt
•
Menschen streben nach Selbstverwirklichung
Carl Rogers (1902 – 1987), einer der Mitbegründer der Humanistischen Psychologie und Begründer der
„Klientenzentrierten Psychotherapie“ (Gesprächspsychotherapie), geht davon aus, dass der Mensch im Laufe
seines Lebens ein Selbstkonzept entwickelt. Es entsteht durch die verschiedenen Erfahrungen, die ein Mensch
über sich selbst macht und spiegelt das wider, was man selbst über sich zu wissen glaubt. Darunter versteht man
das Selbstbild des Menschen. Wer oder was bin ich und was kann ich. Das Selbstkonzept hat Einfluss auf innere
Prozesse sowie auf das Verhalten zur Umwelt. Das Selbstkonzept muss nicht der Realität entsprechen.
Unterschätzt sich ein Mensch selbst, dann hat er ein geringes Selbstwertgefühl.
Es gibt ein ideales Selbst (so will ich sein) und ein reales Selbst (so bin ich wirklich). Wenn zwischen diesen
beiden Selbst-Bildern eine zu große Diskrepanz auftritt, dann kommt es zu Konflikten mit der Umwelt und mit
sich selbst: Unzufriedenheit, Spannungszustände in der Person und mit der Umwelt, Unglücklichsein, …
Rogers versteht das Selbst aber nicht wie Freud als eine innere Instanz, sondern als ein Objekt psychischer
Prozesse. So wie Denken, Erinnern und Wahrnehmen. Das Selbstkonzept oder auch Selbstbild (dazu gehört auch
das Körperbild) entwickelt sich in der Interaktion mit der Umwelt und unterliegt einem ständigen dynamischen
Prozess, der niemals endet.
Das Selbst ist ein „soziales Konstrukt“, es entsteht aus Bewertungen der Umwelt sowie der eigenen.
Bewertungen werden durch Identifikation übernommen oder abgelehnt und im Rahmen dieses Prozesses
entsteht das Selbst als die organisierte Menge an Eigenschaften, die von der Person als etwas Eigenes
empfunden wird: das bin ich!
Eine weitere Kraft im Menschen, die angeboren ist, nannte Rogers die Aktualisierungstendenz oder auch
Selbstaktualisierung, das Streben nach Selbstverwirklichung.
„Der Organismus hat eine grundlegende Tendenz und ein wesentliches Streben, den Erfahrungen machenden
Organismus zu verwirklichen, aufrechtzuerhalten und zu erhöhen.“ (Carl Rogers)
Die Aktualisierungstendenz ist die Tendenz eines jeden Menschen, seine Möglichkeiten so auszuschöpfen, dass
sie der Erhaltung und Förderung des Organismus dienen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Menschen jede
Erfahrung, die sie machen, danach bewerten, ob sie gut oder schlecht für sie selbst ist. Erfahrungen werden
zudem mit dem Selbstbild abgeglichen. Das Selbstbild soll aufrecht erhalten bleiben, auch wenn sich die
Persönlichkeit von der Realität entfernt. Der Organismus ist bestrebt, eine innere Übereinstimmung mit dem
Selbstbild aufrecht zu erhalten. Das nennt Rogers „Selbst-Konsistenz“.
Eine gesunde Persönlichkeit entsteht aus der Interaktion mit der Umwelt, bei der sich eine hohe
Übereinstimmung (Kongruenz) zwischen dem realen Selbst und dem idealen Selbst entwickelt. Das reale Selbst
ist das, was wir sind und das ideale Selbst ist das, was wir sein wollen.
Reales Selbst und ideales Selbst in Übereinstimmung: „Kongruenz“
Im Verlaufe dieses Prozesses gewinnt die Persönlichkeit an Reife. Eine reife Persönlichkeit nach Rogers
entwickelt verschiedene Einstelllungen und Haltungen, die zur Selbstverwirklichung führen:
•
Selbstverantwortlichkeit für das eigene Tun und für das eigene Leben
•
Selbstachtung und Wertschätzung
•
Entwicklung von Lebenswerten
•
Selbstvertrauen entwickeln, Vertrauen ins Leben
•
Offenheit für (neue) Erfahrungen, sich selbst erleben und wahrnehmen, Gefühle und innere Vorgänge
erkennen
•
Aus der Vergangenheit lernen, die Zukunft aktiv planen, aber im Hier und Jetzt leben
•
Freiheit entwickeln, indem wir bewusste Entscheidungen treffen und diese verantworten
•
Selbstverwirklichung auch im sozialen Kontext zu praktizieren, Kreativität, frei schöpferisch zu sein und
anderen auf ihren Weg der Selbstentfaltung zu unterstützen.
„Sie brauchen keine neuen Methoden, sondern eine andere Haltung. Kein Ansatz, der sich auf Wissen, auf
Training, auf die Annahme irgendeiner Lehre verlässt, kann auf Dauer von Nutzen sein. Haltung ist entscheidend
nicht Worte.“ Prof. Dr. Carl Ranson Rogers
Und nun?!
Nun haben wir einen kleinen Ausschnitt aus der Persönlichkeitspsychologie kennen gelernt und es gäbe noch so
vieles dazu zu sagen. Wie hilft uns dieses Wissen nun weiter, können wir uns damit nun besser verstehen?
Gerade die Psychologie, genauso wie Philosophie und Theologie, haben so viele und unterschiedliche
Sichtweisen und Meinungen über die Natur des Menschen. Sie können spalten oder aber auch verbinden.
Häufig spalten sie, denn es geht um etwas sehr Wichtiges, das Wichtigste vielleicht überhaupt: unseren Selbst-
Wert!
„Wie kann man das denn nicht verstehen?! Das ist doch ganz selbstverständlich!“ Hört man so oft. „Sei doch
nicht immer so …“ oder „wie kann man sich in einer solchen Situation nur so verhalten?!
Da treffen manchmal ganz verschiedene Persönlichkeiten aufeinander und die Gräben dazwischen können tief
sein.
Unterschiedliche Kulturen innerhalb einer Gesellschaft müssen heute miteinander zurechtkommen, miteinander
leben und arbeiten. Gegensätze ziehen sich aber auch an, das Fremde und Andere kann sehr attraktiv sein. Aber
auf Dauer verlangt ein Zusammenleben viel Flexibilität und Toleranz.
Schauen wir aber erst einmal im eigenen Umfeld, da finden sich zahlreiche Beispiele für Missverständnisse,
Konflikte und Spannungen, die auf unterschiedlichen Einstellungen, Ansichten, Verhaltensweisen, Erwartungen
und Bedürfnissen zu tun haben. In der eigenen Familie sind nicht alle gleich, die Persönlichkeitsunterschiede
können durchaus groß sein. Im Arbeitsleben stellen die größten Herausforderungen die Kommunikation,
Interaktion, Teamarbeit, Führungsaufgaben und Kundenservice, eben „die anderen“ dar. Und aufgrund von
Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich geht viel Kraft, Zeit, Motivation und Geld verloren.
Die eigene und die Persönlichkeitsstruktur der anderen zu verstehen und zu akzeptieren, kann hier schon eine
große Hilfe sein.
Die Suche nach dem „Selbst“
Um an eine Eingangsfrage anzuknüpfen:
Gibt es überhaupt ein „Ich“ von dem wir so selbstverständlich sprechen? Muss an der „Persönlichkeit“ eigentlich
gearbeitet werden? Wird sie entdeckt, entwickelt, entfaltet oder sollte ich mich von ihr lösen?
Wir haben dazu aus der Wissenschaft ganz unterschiedliche Meinungen gehört.
Aus der Gehirnforschung: es gibt gar kein Ich.
Die alten Griechen: die Säfte, also der Stoffwechsel
Die Behavioristen: eine Black Box, der konditionierte Mensch
Tiefenpsychologie: Triebe, Über-Ich, Verdrängung und Unbewusstes, dazwischen das Ich
Das Ich als Ergebnis eines Minderwertigkeitsgefühls, das überwunden werden will?
Ursache-Wirkung oder durch Ziele bestimmt?
Die Persönlichkeit: ein Charakterpanzer?
Alles angeboren oder durch die Umwelt erworben?
Erziehung, Gesellschaft oder erlernt an Vorbildern?
Der Mensch als Wesen, welches sich entfalten und höher entwickeln möchte?
Oder von allem etwas? Und wie hilft uns das nun weiter?
Benötigen wir ein konkretes Handwerkszeug, um uns auf den Weg zu machen? Sowas, wie eine Ausrüstung, um
einen Berg zu erklimmen. Geht die Reise nach oben, in die Tiefe, in die Vergangenheit oder nach Innen?
Welche Vorstellungen haben Sie von sich selbst? Welchen Einfluss hatte dabei Kindheit, Elternhaus oder Schule?
Wie erleben sie sich in verschiedenen Situationen? Was sagen die Menschen aus Ihrem Umfeld? Welche
Reaktionen auf das eigene Handeln von Ihren Mitmenschen haben Sie manchmal, öfters, regelmäßig
wahrgenommen? Gibt es Konflikte, Spannungen, mit wem ist die Zusammenarbeit angenehm und störungsfrei,
mit wem verstehen Sie sich mit Leichtigkeit?
Fühlen Sie sich erfüllt, am richtigen Platz, ausgeglichen? Leben Sie Ihr Potential, kennen Sie Ihre Stärken? Leben
Sie das Leben, was Sie sich wünschen? Was bedeutet für Sie Selbstverwirklichung?
Sind solche oder andere Fragen der Weg zur Erkenntnis? Ja, Fragen waren stets ein wesentlicher Schlüssel, um
sich oder etwas besser zu verstehen.
Sie haben hoffentlich das Fragenstellen noch nicht aufgegeben! Die richtigen Fragen zu stellen ist ein wichtiges
Handwerkszeug auf dem Weg zur Erkenntnis.
Große Teile der Wissenschaft suggerieren, dass sie schon alles wüssten und verstanden hätten. Der Mensch
glaubt das gerne und fühlt sich so in „Sicherheit“. Der Mutige macht such auf den Weg ins Unbekannte.
„Wenn ich nicht weiß, dass ich nicht weiß, dann glaube ich, ich weiß!“ (Ronald D. Laing, 1972)
„Ich weiß, dass ich nicht weiß!“ (Sokrates)
Knut Diederichs, 14.10.2022
Copyright:
Das Kopieren und die Weiterverarbeitung von Text, Textpassagen oder Grafiken aus diesem Artikel unterliegt dem
Copyright.
Wissenswertes
Wer bin ich und wenn ja, wie viele

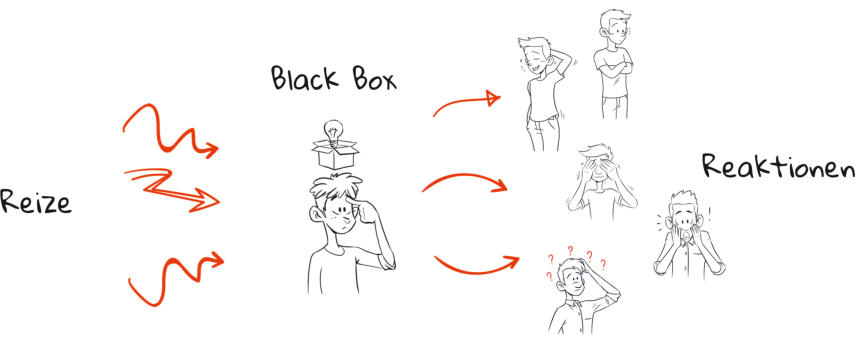

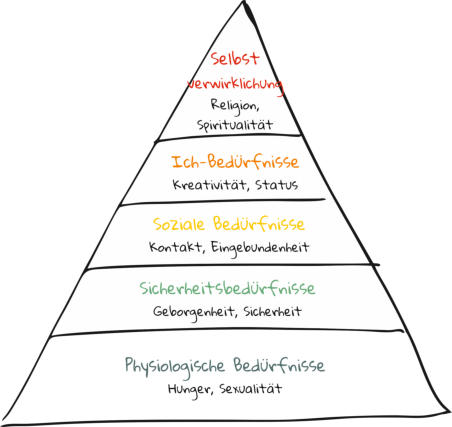
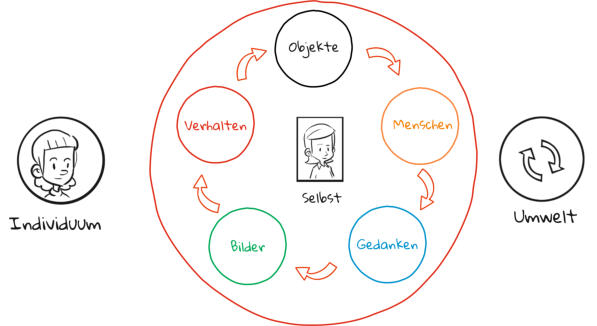
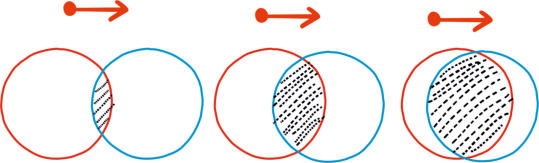
Comesstr. 2-4
50321 Brühl
T: 02232 30 32 711
M: 0171 123 05 47
kd@knut-diederichs.de
Behaviorismus
Die Seele ist eine „Black Box“
Es war einmal ein Psychologe, der hatte einen Hund. Mit dem
machte er gerne Experimente. Er hieß Pawlow. Also, der
Psychologe hieß Pawlow, Iwan Pawlow (1849 – 1936), wie der
Hund hieß, weiß ich nicht mehr.
Und wie ein Hund so ist, sabberte er viel, wenn er etwas zu fressen
sah. Der Hund kam in eine Vorrichtung, die gleichzeitig messen
konnte, wieviel Speichel der Hund produzierte. Dem Hund wurde
ein Leckerli gezeigt und daraufhin fing der Hund an, ordentlich zu
sabbern.
Dann wurde eine Glocke geläutet. Aber der Hund sabberte
überhaupt nicht, wenn er die Glocke hörte. Warum auch?!
Dann wurde immer wieder die Glocke geläutet und gleichzeitig das
Leckerli gezeigt. Irgendwann sabberte der Hund schon allein,
wenn er die Glocke hörte. Obwohl weit und breit kein Leckerli zu
sehen oder zu riechen war.
Daraus schloss Pawlow, dass der Hund etwas gelernt habe.
Nämlich immer, wenn die Glocke läutet, gibt es Happi Happi. Igor -
jetzt fällt es mir wieder ein - Igor hieß der Hund, hat also auf einen
Reiz (unbedingter Reiz) mit einem angeborenen Verhalten
(unbedingter Reflex) reagiert. Die Glocke wurde durch
Wiederholung und in zeitlichem Zusammenhang mit dem
unbedingten Reiz zu einem bedingten Reiz. Sabbert der Hund
allein schon, wenn die Glocke ertönt, dann ist dieses Verhalten ein
bedingtes Verhalten, der Reflex ein bedingter Reflex. Diese Art von
Lernen nannte Pawlow „klassische Konditionierung“.
Und schon war eine neue Psychologie geboren: der
Behaviorismus.
Nein, so einfach war es natürlich nicht. An dieser
wissenschaftlichen Schule waren einige Forscher beteiligt. Zum
Beispiel John B. Watson, der aus der Psychologie eine
naturwissenschaftliche „objektive“ Methode machen wollte, was
eine nachvollziehbare Berechtigung hat.
Auch, wenn viele glauben, sie wären nicht konditionierbar, wie ein
Hund oder eine Hündin, und weil es vielleicht kein besonders
attraktives Menschenbild darstellt, so basiert der Behaviorismus
grundsätzlich auf ganz wesentlichen und schwer von der Hand zu
weisenden Prämissen.
Was tatsächlich in einem Organismus passiert, kann man mit
Genauigkeit nicht sagen. Zumindest nicht von außen. Das kann,
wenn überhaupt, nur der Betroffene selbst sagen. Daher ist der
Organismus für den klassischen Behaviorismus eine „Black Box“.
Oder auch unser Gehirn.
Aber man kann etwas messen, wenn die Parameter eindeutig
formuliert sind: nämlich was rein geht und was raus geht. Also den
oder die Reize, die auf einen Organismus treffen und die
Reaktionen, die ein Organismus hervorbringt. Und das ist sehr gut
quantifizierbar. Selbstverständlich muss das in Experimenten ganz
genau gesteuert werden.
Alle Reize, sprich die Umwelt, formt dem Behaviorismus nach
(auch als Lerntheorie bekannt), die Persönlichkeit. Tiefere
seelische Ebenen, wie die Psychoanalyse vermutet, die zudem
erschlossen und interpretiert oder erfühlt werden müssen,
interessieren hier nicht. Sondern nur messbare Faktoren.
Neben der „klassischen Konditionierung“ (Beispiel „Hund“) gibt es
die „operante Konditionierung“, die durch B.F. Skinner (1904 –
1990) geprägt wurde. Dabei verändert sich das Verhalten dadurch,
dass es belohnt oder bestraft wird. Alle Eltern setzen diese
Methoden mehr oder weniger in der Kindererziehung ein. Wenn
das Kind brav war, dann bekommt es einen Riegel Schokolade. Das
wäre eine positive Verstärkung. Wenn das Kind sich endlich an
gewünschte Regeln hält, dann wird der Stubenarrest aufgehoben
und es darf sich wieder mit den Freunden treffen. Der Stubenarrest
entfällt. Das nennt man dann eine negative Verstärkung. Bei der
Bestrafung ist es umgekehrt.
Und das funktioniert eben nicht nur bei Kindern, auch Erwachsene
sind dadurch formbar. Vielleicht wirkt da kein Riegel Schokolade
mehr als Belohnung, sondern eher eine Bratwurst … oder es gibt
Anerkennung auf geistiger Ebene: der „Mitarbeiter des Jahres“,
oder ein verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft.
Was erlernt werden kann, kann auch wieder verlernt werden. Der
Mensch hat also Einfluss auf sein eigenes Verhalten oder das der
anderen. Daraus ist die Verhaltenstherapie entstanden.
Lernen am Modell
Lernen vollzieht sich sehr häufig und im Kindesalter ganz
besonders, durch die Orientierung an Vorbildern.
Kinder sind hervorragende und äußerst aufmerksame Beobachter
und orientieren sich selbstverständlich bevorzugt an ihrer
Umgebung und an ihre Bezugspersonen. Sie sehen, was andere
tun und imitieren deren Verhalten gerne. Dadurch lernen sie. Man
nennt dieses Lernen auch: „Lernen am Modell“. Und dieses Lernen
betrifft nicht nur das Verhalten, sondern auch Einstellungen,
Werte, Urteile und Gefühlsstrukturen.
„Lernen am Modell“ ist eine sozialkognitive Lerntheorie, die von
Albert Bandura (1925 – 2021) entwickelt wurde. Das verweist auf
den sozialen Aspekt der Interaktion und auf den Aspekt, dass das
Beobachtete auch aktiv verarbeitet werden kann (kognitiv). Dies
passiert mit zunehmendem Alter. Dann können aber schon
bestimmte Grundlagen vorhanden sein, auf die dann unbemerkt
weiter aufgebaut wird.
Karl Valentin sagte treffend. „Wir brauchen unsere Kinder nicht zu
erziehen, sie machen uns sowieso alles nach!“
Der Lerneffekt muss nach Bandura zudem nicht sofort erkennbar
werden. Er kann sich auch erst sehr viel später zeigen oder durch
Modellierungseffekte in späteren ganz unterschiedlichen
Kontexten wieder auftauchen. Auch Beschreibungen reichen
schon, damit ein Lernprozess stattfindet und das Erlernte kann auf
andere Bereiche übertragen werden.
Kultur, gleichgültig welchen Inhalts und welcher Qualität, dringt so
in jeden Menschen ein und wirkt.
Es gibt ein Medium, welches sich zur Konditionierung ganz
besonders eignet, das ist das Fernsehen und in seiner Erweiterung,
das Internet. Denn diese Medien bieten alles, was zur
Konditionierung notwendig ist:
Bilder, Emotionen, Sprache (Information und Botschaft),
unterschwellige Botschaften, Belohnung („Leckerli“),
Wiederholung („Glocke“) und Verknüpfung unendlich vieler
Aspekt, die nichts miteinander zu tun haben müssen („Leckerli und
Glocke).
Und das funktioniert nicht nur bei Kindern und das weiß man!
Die Industrie nutzt diese Aspekte schon lange und daher hat
Werbung einen solch hohen Stellenwert. Aber auch die Politik und
die Medien sind sich der Möglichkeiten bewusst und nutzen diese
zur Meinungsbildung.
Humanistische Ansätze
Die Tiefenpsychologie und der Behaviorismus waren einseitig auf
psychopathologische Erscheinungen ausgerichtet. Das heißt, sie
lagen ihren Fokus auf die „kranken“ Aspekte des Menschen. Freuds
gesammelte Werke sollen über vierhundert Äußerungen über
Neurose enthalten, aber keine einzige über Gesundheit.
In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts wandten sich
immer mehr Psychologen den gesunden Aspekten des Menschen
zu, bzw. fragten sich, was ist eigentlich eine gesunde
Persönlichkeit und wie sieht die Selbstverwirklichung und
Entfaltung des Menschen aus? Das „warum“ der Psychoanalyse
wurde ausgetauscht in ein „wie“ und damit wurden die Fähigkeit
des wachsamen Erlebens, das Bewusstsein im „Hier und Jetzt“
sowie die Frage nach dem Sinn zu zentralen Aspekten der
Betrachtung.
Die Humanistische Psychologie wollte den Menschen als Ganzes
erfassen und ihn nicht in seine Einzelteile zerlegen und diese dann
untersuchen. Eine ganzheitliche Sichtweise schließt das
unmittelbare Erleben des Menschen ein und, in einer
therapeutischen Situation, auch die Anwesenheit und den Einfluss
des Therapeuten mit seiner Persönlichkeit und Geschichte. Das
veränderte die therapeutische Arbeit grundlegend und öffnete die
Türen für ganz neue Methoden und Ansätzen.
Kernpostulate der Humanistischen Psychologie wurden demnach:
•
Menschliche Wesen sind mehr als “die Summe ihrer Teile”
•
Menschliche Wesen leben in zwischenmenschlichen
Beziehungen und Kontexten
•
Menschliches Bewusstsein beinhaltet ein Selbst-Bewusstsein,
dass erweiterbar und schärfbar ist
•
Menschliche Wesen besitzen Wahlmöglichkeiten und
Verantwortlichkeiten – d.h. sie können entscheiden
Was ist ein gesunder und erfüllter Mensch und vor allem, wie ist er
und wie fühlt, lebt und agiert dieser Mensch?
Man wandte sich dem Studium solcher erfüllten und
selbstverwirklichten Menschen zu. Man wandte sich den Themen
Religion, Spiritualität und Gipfelerfahrungen zu.
“Selbstverwirklichende Menschen, Menschen also, die einen
hohen Grad der Reife, Gesundheit und Selbsterfüllung erreicht
haben, können uns so viel lehren, dass sie manchmal fast wie eine
andere Rasse menschlicher Wesen erscheinen.” (Prof. Abraham H.
Maslow)
Abraham Maslow (1908 – 1970) beschäftigte sich unter anderem
auch mit den menschlichen Bedürfnissen. Er postulierte, dass der
Mensch seine grundlegenden Bedürfnisse würdigen sollte und sich
dann den höheren sozialen Bedürfnissen und den Bedürfnissen
der Selbstverwirklichung zu zuwenden.
Daraus ist eine „Hierarchie der Bedürfnisse“ entstanden.
Die Humanistische Psychologie bietet nicht wirklich ein neues
Persönlichkeitsmodell, in der Art, wie wir es bisher gelesen haben,
sondern eher ein besonderes Verständnis der menschlichen Natur.
Sie ist eher eine Anthropologie.
Die Grundannahmen der Humanistischen Psychologie sind:
•
Der Mensch verfügt über einen freien Willen (Freiheit satt
Determinismus)
•
Der Mensch ist von Natur aus gut
•
Menschliche Werte, Kreativität und die aktive Natur des
Menschen stehen im Mittelpunkt
•
Menschen streben nach Selbstverwirklichung
Carl Rogers (1902 – 1987), einer der Mitbegründer der
Humanistischen Psychologie und Begründer der
„Klientenzentrierten Psychotherapie“ (Gesprächspsychotherapie),
geht davon aus, dass der Mensch im Laufe seines Lebens ein
Selbstkonzept entwickelt. Es entsteht durch die verschiedenen
Erfahrungen, die ein Mensch über sich selbst macht und spiegelt
das wider, was man selbst über sich zu wissen glaubt. Darunter
versteht man das Selbstbild des Menschen. Wer oder was bin ich
und was kann ich. Das Selbstkonzept hat Einfluss auf innere
Prozesse sowie auf das Verhalten zur Umwelt. Das Selbstkonzept
muss nicht der Realität entsprechen. Unterschätzt sich ein Mensch
selbst, dann hat er ein geringes Selbstwertgefühl.
Es gibt ein ideales Selbst (so will ich sein) und ein reales Selbst (so
bin ich wirklich). Wenn zwischen diesen beiden Selbst-Bildern eine
zu große Diskrepanz auftritt, dann kommt es zu Konflikten mit der
Umwelt und mit sich selbst: Unzufriedenheit, Spannungszustände
in der Person und mit der Umwelt, Unglücklichsein, …
Rogers versteht das Selbst aber nicht wie Freud als eine innere
Instanz, sondern als ein Objekt psychischer Prozesse. So wie
Denken, Erinnern und Wahrnehmen. Das Selbstkonzept oder auch
Selbstbild (dazu gehört auch das Körperbild) entwickelt sich in der
Interaktion mit der Umwelt und unterliegt einem ständigen
dynamischen Prozess, der niemals endet.
Das Selbst ist ein „soziales Konstrukt“, es entsteht aus
Bewertungen der Umwelt sowie der eigenen. Bewertungen
werden durch Identifikation übernommen oder abgelehnt und im
Rahmen dieses Prozesses entsteht das Selbst als die organisierte
Menge an Eigenschaften, die von der Person als etwas Eigenes
empfunden wird: das bin ich!
Eine weitere Kraft im Menschen, die angeboren ist, nannte Rogers
die Aktualisierungstendenz oder auch Selbstaktualisierung, das
Streben nach Selbstverwirklichung.
„Der Organismus hat eine grundlegende Tendenz und ein
wesentliches Streben, den Erfahrungen machenden Organismus
zu verwirklichen, aufrechtzuerhalten und zu erhöhen.“ (Carl
Rogers)
Die Aktualisierungstendenz ist die Tendenz eines jeden Menschen,
seine Möglichkeiten so auszuschöpfen, dass sie der Erhaltung und
Förderung des Organismus dienen. Das bedeutet nichts anderes,
als dass Menschen jede Erfahrung, die sie machen, danach
bewerten, ob sie gut oder schlecht für sie selbst ist. Erfahrungen
werden zudem mit dem Selbstbild abgeglichen. Das Selbstbild soll
aufrecht erhalten bleiben, auch wenn sich die Persönlichkeit von
der Realität entfernt. Der Organismus ist bestrebt, eine innere
Übereinstimmung mit dem Selbstbild aufrecht zu erhalten. Das
nennt Rogers „Selbst-Konsistenz“.
Eine gesunde Persönlichkeit entsteht aus der Interaktion mit der
Umwelt, bei der sich eine hohe Übereinstimmung (Kongruenz)
zwischen dem realen Selbst und dem idealen Selbst entwickelt.
Das reale Selbst ist das, was wir sind und das ideale Selbst ist das,
was wir sein wollen.
Reales Selbst und ideales Selbst in Übereinstimmung:
„Kongruenz“
Im Verlaufe dieses Prozesses gewinnt die Persönlichkeit an Reife.
Eine reife Persönlichkeit nach Rogers entwickelt verschiedene
Einstelllungen und Haltungen, die zur Selbstverwirklichung
führen:
•
Selbstverantwortlichkeit für das eigene Tun und für das eigene
Leben
•
Selbstachtung und Wertschätzung
•
Entwicklung von Lebenswerten
•
Selbstvertrauen entwickeln, Vertrauen ins Leben
•
Offenheit für (neue) Erfahrungen, sich selbst erleben und
wahrnehmen, Gefühle und innere Vorgänge erkennen
•
Aus der Vergangenheit lernen, die Zukunft aktiv planen, aber
im Hier und Jetzt leben
•
Freiheit entwickeln, indem wir bewusste Entscheidungen
treffen und diese verantworten
•
Selbstverwirklichung auch im sozialen Kontext zu praktizieren,
Kreativität, frei schöpferisch zu sein und anderen auf ihren Weg
der Selbstentfaltung zu unterstützen.
„Sie brauchen keine neuen Methoden, sondern eine andere
Haltung. Kein Ansatz, der sich auf Wissen, auf Training, auf die
Annahme irgendeiner Lehre verlässt, kann auf Dauer von Nutzen
sein. Haltung ist entscheidend nicht Worte.“ Prof. Dr. Carl Ranson
Rogers
Und nun?!
Nun haben wir einen kleinen Ausschnitt aus der
Persönlichkeitspsychologie kennen gelernt und es gäbe noch so
vieles dazu zu sagen. Wie hilft uns dieses Wissen nun weiter,
können wir uns damit nun besser verstehen?
Gerade die Psychologie, genauso wie Philosophie und Theologie,
haben so viele und unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen
über die Natur des Menschen. Sie können spalten oder aber auch
verbinden.
Häufig spalten sie, denn es geht um etwas sehr Wichtiges, das
Wichtigste vielleicht überhaupt: unseren Selbst-Wert!
„Wie kann man das denn nicht verstehen?! Das ist doch ganz
selbstverständlich!“ Hört man so oft. „Sei doch nicht immer so …“
oder „wie kann man sich in einer solchen Situation nur so
verhalten?!
Da treffen manchmal ganz verschiedene Persönlichkeiten
aufeinander und die Gräben dazwischen können tief sein.
Unterschiedliche Kulturen innerhalb einer Gesellschaft müssen
heute miteinander zurechtkommen, miteinander leben und
arbeiten. Gegensätze ziehen sich aber auch an, das Fremde und
Andere kann sehr attraktiv sein. Aber auf Dauer verlangt ein
Zusammenleben viel Flexibilität und Toleranz.
Schauen wir aber erst einmal im eigenen Umfeld, da finden sich
zahlreiche Beispiele für Missverständnisse, Konflikte und
Spannungen, die auf unterschiedlichen Einstellungen, Ansichten,
Verhaltensweisen, Erwartungen und Bedürfnissen zu tun haben. In
der eigenen Familie sind nicht alle gleich, die
Persönlichkeitsunterschiede können durchaus groß sein. Im
Arbeitsleben stellen die größten Herausforderungen die
Kommunikation, Interaktion, Teamarbeit, Führungsaufgaben und
Kundenservice, eben „die anderen“ dar. Und aufgrund von
Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich geht viel Kraft, Zeit,
Motivation und Geld verloren.
Die eigene und die Persönlichkeitsstruktur der anderen zu
verstehen und zu akzeptieren, kann hier schon eine große Hilfe
sein.
Die Suche nach dem „Selbst“
Um an eine Eingangsfrage anzuknüpfen:
Gibt es überhaupt ein „Ich“ von dem wir so selbstverständlich
sprechen? Muss an der „Persönlichkeit“ eigentlich gearbeitet
werden? Wird sie entdeckt, entwickelt, entfaltet oder sollte ich
mich von ihr lösen?
Wir haben dazu aus der Wissenschaft ganz unterschiedliche
Meinungen gehört.
Aus der Gehirnforschung: es gibt gar kein Ich!
Die alten Griechen: die Säfte, also der Stoffwechsel
Die Behavioristen: eine Black Box, der konditionierte Mensch
Tiefenpsychologie: Triebe, Über-Ich, Verdrängung und
Unbewusstes, dazwischen das Ich
Das Ich als Ergebnis eines Minderwertigkeitsgefühls, das
überwunden werden will?
Ursache-Wirkung oder durch Ziele bestimmt?
Die Persönlichkeit: ein Charakterpanzer?
Alles angeboren oder durch die Umwelt erworben?
Erziehung, Gesellschaft oder erlernt an Vorbildern?
Der Mensch als Wesen, welches sich entfalten und höher
entwickeln möchte?
Oder von allem etwas? Und wie hilft uns das nun weiter?
Benötigen wir ein konkretes Handwerkszeug, um uns auf den Weg
zu machen? Sowas, wie eine Ausrüstung, um einen Berg zu
erklimmen. Geht die Reise nach oben, in die Tiefe, in die
Vergangenheit oder nach Innen?
Welche Vorstellungen haben Sie von sich selbst? Welchen Einfluss
hatte dabei Kindheit, Elternhaus oder Schule? Wie erleben sie sich
in verschiedenen Situationen? Was sagen die Menschen aus Ihrem
Umfeld? Welche Reaktionen auf das eigene Handeln von Ihren
Mitmenschen haben Sie manchmal, öfters, regelmäßig
wahrgenommen? Gibt es Konflikte, Spannungen, mit wem ist die
Zusammenarbeit angenehm und störungsfrei, mit wem verstehen
Sie sich mit Leichtigkeit?
Fühlen Sie sich erfüllt, am richtigen Platz, ausgeglichen? Leben Sie
Ihr Potential, kennen Sie Ihre Stärken? Leben Sie das Leben, was
Sie sich wünschen? Was bedeutet für Sie Selbstverwirklichung?
Sind solche oder andere Fragen der Weg zur Erkenntnis? Ja, Fragen
waren stets ein wesentlicher Schlüssel, um sich oder etwas besser
zu verstehen.
Sie haben hoffentlich das Fragenstellen noch nicht aufgegeben!
Die richtigen Fragen zu stellen ist ein wichtiges Handwerkszeug auf
dem Weg zur Erkenntnis.
Große Teile der Wissenschaft suggerieren, dass sie schon alles
wüssten und verstanden hätten. Der Mensch glaubt das gerne und
fühlt sich so in „Sicherheit“. Der Mutige macht such auf den Weg
ins Unbekannte.
„Wenn ich nicht weiß, dass ich nicht weiß, dann glaube ich, ich
weiß!“ (Ronald D. Laing, 1972)
„Ich weiß, dass ich nicht weiß!“ (Sokrates)
Knut Diederichs, 14.10.2022
Copyright:
Das Kopieren und die Weiterverarbeitung von Text, Textpassagen
oder Grafiken aus diesem Artikel unterliegt dem Copyright.

Wissenswertes
Wer bin ich und wenn ja, wie viele

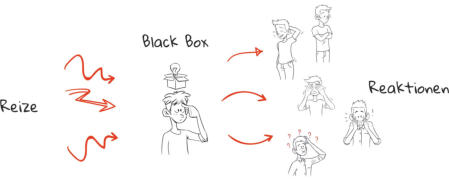

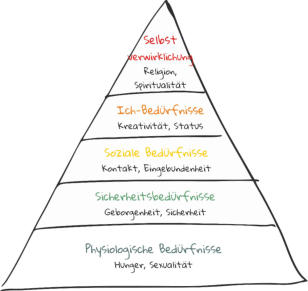
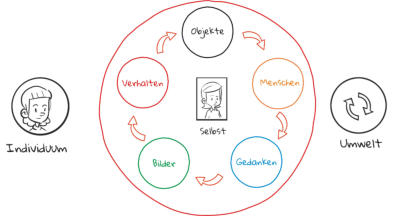
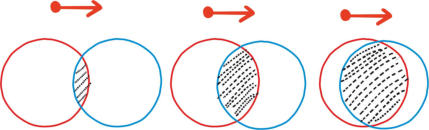
Leistungen
Comesstr. 2-4
50321 Brühl
T: 02232 30 32 711
M: 0171 123 05 47
kd@knut-diederichs.de
KNUT-
DIEDERICHS
PUNKT DE
Über mich
Weitere Links














